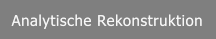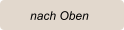
Ein Vergleich vom Triebwerk 1,7/250 des Raketenflugplatz
und dem Triebwerk des A2 (modifizierter A1-Motor) legt
einen Austausch von Ideen und Daten und nahe.
Interessant ist hier ein Vergleich der Öffnungswinkel der
Düsen. Bis zum April 1932 hatten die Heylandt-Werke in
Berlin-Britz dazu Versuche für das HWA unternommen und
einen Winkel von 15 Grad als optimal ermittelt. Die Düse
des Raketenflugplatz liegt mit einem Öffnungswinkel von
13,5 Grad sehr dicht an diesem Optimum. Die Düse von
Wernher von Braun bleibt mit 10 Grad deutlich darunter.
Dafür erbringt das HWA-Tiebwerk eine höhere Ausström-
geschwindigkeit, wohl ein Ergbenis der besseren Treibstoff-
vermischung im Triebwerk.
Aggregat A1 und A2 aus Kummersdorf
Ende 1932 wechselte Wernher von Braun mit seiner Tätigkeit
vom Raketenflugplatz-Berlin zum Heereswaffenamt (HWA)
nach Kummersdorf. Hier machte er sich an die Versuche für
Flüssigkeitstriebwerke und auch bald an die Konstruktion der
ersten Flüssigkeitsrakete des HWA: dem Aggregat A1.
Da dies eine militäriche Entwicklung war, liefen die Arbeiten
unter den strengen Geheimhaltungsvorschriften des Heeres.
Dennoch scheint die Kommunikation der Berliner Raketen-
forscher untereinander nicht abgerissen zu sein. Zum Einen
sah man sich weiterhin auf den Treffen des Vereins für
Raumschiffahrt. Zum Anderen waren etliche der Pioniere
miteinander eng befreundet, etwa Wernher von Braun und
Klaus Riedel.
Im Museum der Royal Air Force in Cosford sind eine
Taifun mit Flüssigkeitsantrieb (oben) und eine
Version mit Feststoff ausgestellt.
Das Triebwerk des Aggregat A2 des Heeres von 1934
entsprach der Größe des 1,7/250 und leistete
ungefähr 300 bis 320 kp.
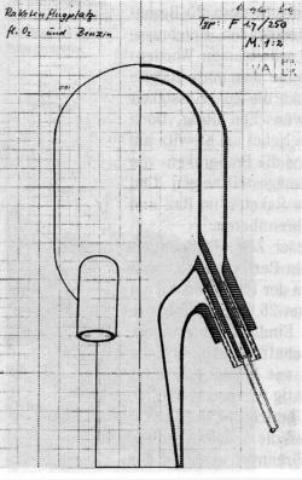
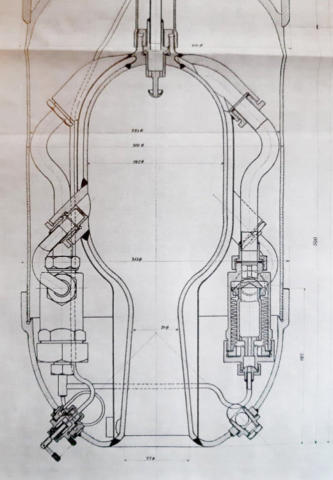
Triebwerk 1,7/250 des Raketenflugplatz-Berlin1933.
Bei einem Soll-Schub von 250 kp wurden meist 170
bis 200 kp erreicht.


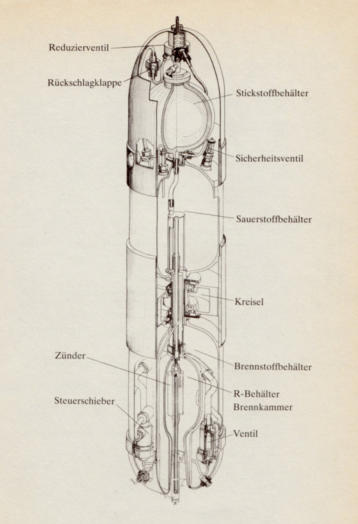

Vergleich der inneren Brennkammern und Düsen
1,7/250
2B2
Raketenfluplatz Kummersdorf
Länge gesamt
420 mm
440 mm
Innen-Durchmesser
112 mm
160 mm
Länge der Düse
160 mm
150 mm
Engster Querschnitt
34 mm
51 mm
Düsenmund
72 mm
77 mm
Öffnungswinkel
13,5 Grad
10 Grad
Verhältnis Düse zur
Gesamtlänge
38 %
34 %
Brennstoff
Benzin
Ethanol
Oxidator
LOX
LOX
Ausströmgeschw.
ca. 890 m/s
ca. 1500 m/s
Schub Soll
250 kp
300 kp
Schub praktisch
170 - 200 kp
300 - 320 kp
Anmerkungen:
- Die Abmessungen des 1,7/250 wurden der vorliegenden
Zeichnung entnommen und sind so mit einer gewissen
Unsicherheit behaftet.
- Die Ausströmgeschwindigkeit des 1,7/250 wurde von
Dr.-Ing. Olaf Przybildki in seinem Buch “Raketentriebwerke”
errechnet.
Foto des A1-Motors 2B mit äußerer Hülle als Kühlmantel,
montiert auf dem Boden des Brennstofftanks. Foto aus
der Dissertation Wernher von Brauns, 1934.
Aggregat A2
Das als erstes konstruierte und gebaute Aggregat A1 hatte
den Stabilisierungskreisel vorn unter der Bughaube und
hätte so nicht stabil fliegen können. Beim A2 wurde der
Kreisel in die Rumpfmitte verlegt und gleich etliche
Änderungen am Treibstoff-Fördersystem vorgenommen.
Zwei Exemplare des A2 flogen am 19. und 20. Dezember
1935 erfolgreich von der Insel Borkum. Dort befand sich
eine Artillerie-Versuchsstelle der Marine mit Messgeräten.
Die beiden Geräte, genannt “Max” und “Moritz”, wurden aus
einem Startgestell mit Schienen zur Führung heraus
verschossen und erreichten eine Flughöhe von etwa 2200
und 3500 Metern.
Länge
1610 mm
Durchmesser max.
314 mm
Startmasse
105 kg
Leermasse
72 kg
Schub
320 kp, fallend auf etwa 240 kp
Brenndauer
16 Sekunden
Nachbau des
Aggregat A1 und A2
Klaus Schlingmann hat damit
begonnen, Teile der Aggregate A1
und A2 nachzubauen.
Begonnen hat er mit dem Triebwerk
des A1 und dem dazugehörigen
Deckel des Treibstofftanks.
Im Vergleich ist links das Original
und rechts der Nachbau, noch ohne
Kühlmantel und Leitungen, zu
sehen.
Diese beiden Bilder geben einen
guten Eindruck von der Größe des
Triebwerks.
Klaus Schlingmann ist sichtlich
zufrieden mit seinem Werk.